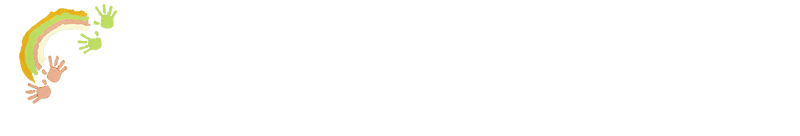Speziell ausgebildete Ergotherapeut:innen unterstützen Betroffene und sind Ansprechpartner:in für Unternehmen bei der beruflichen Wiedereingliederung
Nach einem Unfall oder einer längeren Erkrankung wollen die meisten Betroffenen vor allem eins: ihr altes Leben zurück, was meist auch bedeutet, zurück in den Beruf. "Es ist gesetzlich geregelt, dass Arbeitgeber:innen dies ermöglichen müssen", bestätigt Marian Waßmann, Ergotherapeut im DVE (Deutscher Verband Ergotherapie e.V.) und erwähnt, dass die meisten Unternehmen ohnehin "ihre Leute" weiter beschäftigen wollen. Dank der zielgerichteten Interventionen von Ergotherapeut:innen werden Betroffene ab dem frühestmöglichen Zeitpunkt in jeder Hinsicht auf die berufliche Wiedereingliederung vorbereitet und für genau ihre Tätigkeit fitgemacht. Sobald die Leistungsfähigkeit der Patient:innen es erlaubt und davon auszugehen ist, dass sie den Anforderungen an ihrem Arbeitsplatz wieder gewachsen sind, begleiten hierfür geschulte Ergotherapeut:innen das Wiedereingliederungsverfahren in Betrieben.
Die Erkrankungen und Verletzungen, die eine längere Arbeitsunfähigkeit nach sich ziehen, sind vielfältig - so, wie die Menschen und ihre jeweiligen Tätigkeiten. Der Ergotherapeut Marian Waßmann bringt viele zurück in den Beruf. Sein Klientel ist bunt gewürfelt, vom Berufsfahrer über Mitarbeitende in Büros bis hin zu Menschen, die offshore auf Ölplattformen arbeiten - alles ist dabei und unterschiedlicher geht es nicht. "Je gezielter und gründlicher Menschen auf exakt die Gegebenheiten und Rahmenbedingungen in ihrem persönlichen Tätigkeitsbereich vorbereitet sind, desto leichter fällt ihnen die Rückkehr in Beruf und Arbeit", erklärt der Ergotherapeut Marian Waßmann und das leuchtet ein. Ob die Phase der Wiedereingliederung möglichst gut und möglichst schnell gelingen kann, beruht auch darauf, dass seine Berufskolleg:inen zunächst in den Reha-Kliniken und danach in den niedergelassenen Praxen optimale Vorarbeit geleistet haben. Darauf können Waßmann und Seinesgleichen sich in aller Regel verlassen, denn berufliche Wiedereingliederung gehörte schon in den Anfängen der Ergotherapie zum Kerngeschäft, auch wenn sie erst später so bezeichnet wurde: Ergotherapeut:innen, zunächst Beschäftigungs- und Arbeitstherapeut:innen genannt, haben in Deutschland heimgekehrte Soldaten in das Arbeits- und Berufsleben integriert.
Worauf es ankommt: die exakten Anforderungen des einzelnen Arbeitsplatzes kennen
Was steckt hinter ihrem Erfolg? Ergotherapeut:innen fokussieren sich auf das Individuum und seine ganz besonderen, persönlichen Fähigkeiten, Bedürfnisse und Anliegen und ebenso auf die Betätigung - in diesem Fall die Arbeit. "Es ist im Bereich der beruflichen Wiedereingliederung von elementarer Bedeutung, Menschen gezielt vorzubereiten; jede:n nach "Schema F" ein bestimmtes Gewicht heben, über Kopf arbeiten oder alle denselben Parcours absolvieren zu lassen, passt höchstens stellenweise und hat nichts mit zeitgemäßem Vorgehen zu tun", verdeutlich der Ergotherapeut die zentralen Aspekte seiner Arbeit. Bei Ergotherapeut:innen geht es darum, den Arbeitsplatz und die einzelnen Tätigkeiten bis in alle Einzelheiten zu erfassen. In einem ersten Gespräch bitten sie ihre Patient:innen daher, ihren Arbeitsplatz zu beschreiben. In vertiefenden Fragen klären Ergotherapeut:innen, wie ein typischer Arbeitstag aussieht, welche Aufgaben im Einzelnen zu erfüllen sind und in welchen Körperhaltungen dies geschieht. Auch wollen sie wissen, ob mit Maschinen und Werkzeugen gearbeitet wird, wenn ja, mit welchen, ob der- oder diejenige tragen muss, wenn ja, wieviel, wie weit, wie oft und so weiter und so weiter. Ein entsprechender, speziell hierfür entwickelter Fragenkatalog bildet die Grundlage, um wirklich jeden auch noch so ungewöhnlichen Arbeitsplatz mitsamt seinen Rahmenbedingungen transparent zu machen.
Testen und Evaluieren: Ergotherapeut:innen überprüfen fortwährend die Leistungsfähigkeit
Ein weiterer Parameter, der bei der beruflichen Wiedereingliederung eine Rolle spielt, ist die Leistungsfähigkeit der Patient:innen. Ist geklärt, welche Anforderungen am Arbeitsplatz bestehen, führen Ergotherapeut:innen die ersten Testungen und Evaluationen, also Bewertungen, durch. "Ergotherapeut:innen testen anfangs und dann immer wieder, wo steht der Patient beziehungsweise die Patientin und wie weit sind die derzeitigen Fähigkeiten von dem entfernt, was er oder sie für ihre beruflichen Aufgaben benötigt", sagt Waßmann und veranschaulicht dies exemplarisch: "Der oder die Bäckereifachverkäufer:in muss vor Beginn der beruflichen Wiedereingliederung unter anderem in der Lage sein, Backbleche auf einer bestimmten Höhe in den Ofen zu schieben, Fliesenleger:innen und andere Handwerker:innen müssen sich hinknien, auf den Boden kommen, auf Leitern steigen oder Gewichte tragen können, Mitarbeitende in Büros und Verwaltungen müssen imstande sein, längere Zeit zu sitzen, sich gegebenenfalls auf komplexe Sachverhalte zu konzentrieren und mehr". Um das Training so realitätsnah als möglich zu gestalten, nutzen Ergotherapeut:innen vorzugsweise Therapiegerätesysteme, an denen nahezu jeder Arbeitsplatz mit seinen typischen Arbeits- und Bewegungsabläufen, Arbeitsmaterialien und Werkzeugen nachgestellt werden kann.
Zeitgemäße Ausrichtung: Ergotherapeut:innen gestalten berufliche Wiedereingliederung individuell
Oft sind Hilfsmittel nötig, um nach überstandener Erkrankung oder Verletzung wieder am Arbeitsplatz bestehen zu können. Werkzeuge, die aus superleichtem Material sind, Griffverdickungen, um einen Hammer oder ein anderes Tool besser fassen zu können - Ergotherapeut:innen kümmern sich von Anfang an darum, dass benötigte Hilfsmittel besorgt oder organisiert und wenn möglich vom Kostenträger finanziert werden. Waßmann berichtet von einem Fall, bei dem eine Frau eine Hand wegen einer zu schweren Verletzung nicht mehr zum Schreiben nutzen konnte. Die Abhilfe: eine besondere Tastatur, bei der die Tasten kleiner und enger beieinander liegen, sodass betroffene Personen auch mit nur einer Hand noch schnell tippen können. So finden sich für jede und jeden individuelle Lösungen, damit es gut gewappnet mit der beruflichen Wiedereingliederung losgehen kann. "Die ersten Tage im Betrieb sind zum "Warming-up" da: Aufgelaufene E-Mails checken, Übergaben und andere aktuelle Dinge mit Kolleg:innen besprechen und erledigen - da können die Berufsrückkehrer schon ein erstes Urteil fällen und herausfinden, ob sie klarkommen", beschreibt Waßmann sein Vorgehen. Der Ergotherapeut kommt frühestens ab dem dritten oder vierten Tag in den Betrieb, um zu schauen, wie es läuft, sofern der Kostenträger das unterstützt. Gemeinsam mit seinen Patient:innen begeht der Ergotherapeut den Arbeitsplatzes, begutachtet ergonomische Gegebenheiten und - wenn nötig und hilfreich - adaptiert und passt noch mehr an, um das Arbeiten weiter zu erleichtern oder Abweichungen oder vielleicht auch Kompromisse mit dem Arbeitgeber herbeizuführen. Auch Veränderungen des Wiedereingliederungsplans gehören zu den Aufgaben von Ergotherapeut:innen: Sind die geplanten Arbeitszeitsteigerungen möglich, kann es schneller oder muss es langsamer gehen? Ergotherapeut:innen wie Marian Waßmann besitzen viel Knowhow, sind anerkannte und geschätzte Partner:innen der beteiligten Ärzt:innen, Kostenträger und der Unternehmen. Kurzum: man vertraut sich gegenseitig und weiß die Expertise der Wiedereingliederungsprofis zu schätzen.
Knowhow-Transfer: Fortbildungen zur beruflichen Wiedereingliederung an der DVE Akademie für Ergotherapeut:innen
Das Wissen, das mit den vielen unterschiedlichen Tätigkeiten, Anforderungen und Menschen verknüpft ist, hat Marian Waßmann zunächst von seinem Arbeitgeber erworben und dann durch seine lange Berufserfahrung weiter ausgebaut. Diesen Erfahrungsschatz und alles weitere, worauf es im Bereich der beruflichen Wiedereingliederung ankommt, gibt er gerne weiter. In Fortbildungen der Akademie des DVE (Deutscher Verband Ergotherapie e.V.) vermittelt er seinen Berufskolleg:innen, auf welche Knackpunkte es besonders zu achten gilt und wie ein transparentes Miteinander zum Erfolg führt. "Schlussendlich, und das macht die Arbeit dann besonders erfreulich, ist es so, dass auch die meisten Arbeitgeber mit uns an einem Strang ziehen, um geschätzte Mitarbeiter:innen und deren Können und Wissen im Unternehmen zu behalten", resümiert der Ergotherapeut Waßmann. Dank ihm und seiner im Bereich der beruflichen Wiedereingliederung speziell qualifizierten Berufskolleg:innen gelingt es in vielen Fällen, Menschen nach einer längeren Zeit der Arbeitsunfähigkeit vollumfänglich in ihr Unternehmen zurückzubringen.
Informationsmaterial zu den vielfältigen Themen der Ergotherapie gibt es bei den Ergotherapeut:innen vor Ort; Ergotherapeut:innen in Wohnortnähe auf der Homepage des Verbandes unter https://dve.info/service/therapeutensuche und hier geht's zum Podcast dve-podcast.podigee.io
Bildunterschrift:
Ergotherapeut:innen, die sich auf berufliche Wiedereingliederung spezialisiert haben, orientieren sich - und das ist typisch für diese Berufsgruppe - an den individuellen Fähigkeiten und Möglichkeiten Betroffener. So stellen sie sicher, dass Menschen nach ihrer Erkrankung oder einem Unfall optimal für ihren Wiedereinstieg in das Arbeitsleben vorbereitet sind.